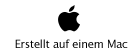KOMMENTARE
2010

Am 25. April beginnt die Lesetour zur Präsentation der Neuausgabe von Heinz Küppers genialem Roman „Simplicius 45“, der im Rahmen der von der Konejung Stiftung: Kultur in der Rheinischen Edition im Verlag Ralf Liebe herausgegebenen Werkausgabe erscheint (Editor: Armin Erlinghagen). Zu den Terminen geht es hier (klicken). Lesen wird der bekannte Sprecher Bodo Primus, der seine markante Stimme zahlreichen Hörspielen, Hörbüchern und Dokumentationen verlieh. 2006 wurde er mit dem Deutschen Hörbuchpreis für „Der Nazi & der Friseur“ ausgezeichnet. Das Vorwort zur Neuausgabe wurde von Achim Konejung verfasst, der die Lesungen mit Filmen vom Kriegsende im Rheinland kommentieren wird.
Vorwort zur Neuausgabe von Simplicius 45
von Achim Konejung
Während ich dieses Nachwort schreibe und mit „Simplicius 45“ der wohl wichtigste Roman von Heinz Küpper im Rahmen der Werkausgabe kurz vor der Neuausgabe steht, findet in Aachen einer der letzten Kriegsverbrecherprozesse der Bundesrepublik sein Ende und wird im Mai der deutschen Kapitulation vor 65 Jahren gedacht. Bei den nächsten runden Gedenkfeierlichkeiten werden weltweit nur noch wenige Männer und Frauen dabei sein, die den ungeheuerlichsten Krieg der Menschheitsgeschichte als Erwachsene miterlebten, und sie werden dann älter sein als die Großväter und Großmütter meiner Jugendzeit, die noch den Kaiser oder das Grauen der Schützengräben gekannt hatten. Das Dritte Reich und der Zweite Weltkrieg werden unweigerlich zur Historie.
Schaut man sich die unzähligen Publikationen zu diesem Thema in den letzten Jahrzehnten an, so mag man fragen, warum nur soll man einen Roman von 1963, der zwar seinerzeit im In- und Ausland durchaus erfolgreich war, später aber mit seinem Autor in Vergessenheit geriet, noch einmal neu auflegen und dem Publikum aufs äußerste empfehlen? Sind nicht unzählige hervorragende Bücher, Filme, Dokumentationen zu fast allen Facetten dieses Krieges und der NS-Diktatur erschienen? Ja, das sind sie. Aber es lohnt sich, nachzuschauen, wann. Und das ist meine Antwort auf die Frage, warum man Küpper heute noch bzw. wieder lesen soll: weil die späte Aufarbeitung der „jüngeren Vergangenheit“ nicht zwangsläufig daraus resultierte, dass es damals keine Autoren gab, die dem Publikum das Angebot gemacht hätten. Denn Küpper war so einer. Er hatte den Mut, das Dritte Reich, den alltäglichen Faschismus, die „ganz normalen 1000 Jahre“ 1 in einer rheinischen Kleinstadt, hier Euskirchen, zu beschreiben. Er hatte den Mut, sich nicht hinter einer Kunstfigur wie zum Beispiel der eines Blechtrommlers, der Hauptfigur von Grass’ genialem Roman, der 4 Jahre vor dem Simplicius erschienen war, zu verstecken, sondern aus der Sicht des begeisterten Pimpfes und Hitlergläubigen den Nationalsozialismus als Faszination zu beschreiben. Mut hatte er, weil er damit, aus der Sicht des Kindes, das am gleichen Tag wie Hitler Geburtstag hatte (wozu der Autor den Ich-Erzähler des Romans um sechs Monate jünger machte als sich selbst) zu dem bekannte, was zur Zeit der Entstehung des Romans keiner mehr wissen wollte und jeder nur hinter vorgehaltener Hand oder im Bierdunst der Stammtische und Familienfeiern, rauchgeschwängert, von sich gab: „Es war doch auch eine tolle Zeit“. Mut hatte Küpper auch, weil er nicht eine anonyme Großstadt beschrieb, mit austauschbarem Personal, in dem sich keiner wiedererkennen musste, sondern weil er sich mit Euskirchen eine überschaubare Kleinstadt vornahm, in der jeder jeden kannte und auch nach dem Krieg jeder wusste, welche Karriere der andere durchlaufen hatte. Und in der es vielleicht besser für die Nachkriegslaufbahn war, wenn man „davor“ auch dabei gewesen war, in den immerwährenden Machtstrukturen, ob als Parteigenosse oder Wehrmachtsoffizier. Und um diesen Mut zu verstehen, müssen wir uns einfach vor Augen halten, was das denn für eine Zeit war, in der Küppers Roman erschien, und wie es mit der Vergangenheitsbewältigung aussah.
1963 war das letzte Jahr der so genannten Adenauer-Ära, 2 einer Zeit, die selber bereits hinter einem historischen Grauschleier liegt, eine muffige, spießige, restaurative Gesellschaft, mit ihrem Dress-Code, der immer noch an die Uniformierung des untergegangen Reiches erinnerte (man muss sich vorstellen, dass damals der soziale Rang eines jeden sofort anhand seiner Kleidung ablesbar war). Mit ihrem Wiederaufbaugeist, der unbekümmert das Personal und die Architekturpläne des untergegangenen Reiches, dessen Rechtsnachfolge man jetzt betrieb, umsetzte. Mit der Wiederbewaffnung, mit der mehrfach erfolgten Amnestie von belasteten Beamten und Soldaten, und der „Schwamm-drüber“- Mentalität, die in der Rückschau allenfalls die Opferrolle zuließ. Schuld und Sühne waren nach Meinung der Deutschen mit dem erlittenen Bombenkrieg, mit Flucht und Vertreibung und der Teilung mehrfach getilgt. Schuldig geworden waren, wenn überhaupt, die wenigen Mittäter, die in Nürnberg verurteilt worden waren und über allem thronte Hitler als das personifizierte Böse, der die Masse der unschuldigen Deutschen verführt hatte. Geschichtsschreibung wurde nicht, wie ein müder Mythos der Rechten noch heute gerne behauptet, von den Siegern, vielmehr von ehemaligen Nazis betrieben, zum Beispiel dem ehemaligen SS Brigadeführer Paul K. Schmidt, der unter dem Pseudonym Paul Carell 3 millionenfache Bestseller über den angeblich sauberen Krieg der Wehrmacht im Osten schrieb. Ach ja, und für die hatte Adenauer 1951 die Ehrenerklärung abgegeben, ein notwendiger Schritt auf dem Weg zur Wiederbewaffnung. Denn die Bundesrepublik Deutschland war Frontstaat im Kalten Krieg und nur so lässt sich erklären, wie es in wenigen Jahren nach dem totalen Zusammenbuch zu solch restaurativen Schritten kam und im Zuge der „Renazifizierung“ in manchen Bundesstaaten schließlich mehr als ein Drittel der Beamten ehemalige Angehörige der NSDAP waren. Oberländer und Globke waren prominente Vertreter des Typus Ex-Nazi und in hohen Regierungspositionen, der einstige stellvertretende Leiter der Rundfunkpolitischen Abteilung im Reichsaußenministerium, auch er NSDAP Mitglied, war Ministerpräsident von Baden-Württemberg und sollte später sogar Bundeskanzler werden: Kurt-Georg Kiesinger. In Küppers Wohn- und Heimatort Euskirchen wurde ein von einem alliierten Gericht in Dachau zum Tode verurteilter Kriegsverbrecher 1954 im Rahmen einer Amnestie begnadigt, stellvertretender Leiter des dortigen Finanzamts. 4
Wo man in die politische Landschaft der 50er und frühen 60er auch hinschaute, galt das Motto Vergessen und Verdrängen. Wie sah es aber mit der Verarbeitung der NS-Zeit in Kunst und Kultur aus? Eine intensive Antwort auf diese Frage würde sicherlich den Rahmen dieses Vorworts sprengen und ist auch an anderer Stelle bereits ausführlich bearbeitet worden. Deshalb möchte ich einige wenige Beispiele anführen: Im unmittelbaren Schock der Niederlage erschien es dem deutschen Publikum keineswegs abstoßend, sich der Verantwortung und der eigenen Schuld zu stellen, das beweist u.a. der große Erfolg des ersten nach der NS-Zeit gedrehten Films, „Die Mörder sind unter uns“ (Regie: W. Staudte, 1946), der genau jene Verbrechen im Osten thematisierte, von denen in den späteren fünfziger Jahren niemand mehr etwas wissen wollte. Denn schon wenig später, mit der Wiedererlangung der Souveränität und im Zuge der Wiederbewaffnung, wurde das Genre der „Trümmerfilme“ von einer Welle von Heimat- und Militärfilmen weggeschwemmt und urplötzlich waren wieder bewaffnete Männer die Helden der Stunde auf deutschen Leinwänden, entweder als Förster im Silberwald oder als Landser, wie z. B. in der Militärschwank-Reihe „08/15“ und einer Reihe von weiteren Filmen, die den Krieg aus der Perspektive des unschuldigen, weil verführten, aber trotzdem seine Pflicht erfüllenden Soldaten darstellte – Opfer und Verfolgte blieben bei diesen beim Publikum äußerst erfolgreichen Produktionen außen vor. Ein weiteres Mal blieb es Wolfgang Staudte überlassen, mit „Rosen für den Staatsanwalt“ in einer brillanten Kinokomödie die Verstrickungen der „furchtbaren Juristen“ in das Unrechtsregime darzustellen. Nicht zu vergessen sei hier der größte aller deutschen Kabarettisten, Wolfgang Neuss, der mit „Wir Kellerkinder“ einen der besten Beiträge zu den antisemitischen Vorfällen, die sich in der Bundesrepublik um die Jahreswende 1959/60 ereignet hatten, 5 schuf. Wieder ein Film, den keiner sehen wollte und der leider bis heute weitgehend unbekannt ist, aber als Einblick in die Adenauer-Verdrängungs-Ära bestens taugt.
Auch in der Literatur, vornehmlich vertreten durch die Mitglieder der Gruppe 47 6, dominierte das Motiv des Deutschen als Opfer, der in einer Zeit, in der „der Krieg herrschte“, sich seine Rolle schließlich nicht aussuchen konnte. Interessant übrigens, wie die Subjektivierung des Krieges, der in der Regel als Menschen mordendes Ungeheuer herrscht, aber keine Väter kennt, sich deckt mit den Beschreibungen der Heimat- und Landser-Literatur und sich diese Betrachtungsweise anscheinend bis heute in diesem Genre ein ewiges Bleiberecht geschaffen hat. Ausnahmen jener Jahre fallen mir nur wenige ein; klar, da wären Böll und Grass, auf die ich später noch zurückkomme, und Wolfgang Koeppen natürlich. In seiner Romantrilogie „Tauben im Gras“ (1951), „Das Treibhaus“ (1953) und „Der Tod in Rom“ (1954) hat er genau jene restaurativen Strömungen der Adenauer-Zeit beschrieben, geliebt wurde er dafür nicht. Die anderen Autoren und Bücher, an die man immerzu denkt? Die kamen erst viel später. Das sollte man wissen, wenn man wissen will, warum Küppers Roman damals Mut erforderte. Die Bereitschaft vieler Autoren, zu diesem Thema zu schreiben und der Leserschaft, dieses auch zu lesen, kam erst nachdem Küpper seinen Roman vollendet hatte.
1963, das Erscheinungsjahr von „Simplicius 45“, war auch ein Jahr des Umbruchs, nicht nur durch den Kanzlerwechsel (im Herbst d. J. wurde Ludwig Erhardt neuer Regierungschef), sondern vor allem durch eine neue Phase der Vergangenheitsbewältigung, die mit dem Frankfurter Auschwitz-Prozess begann. Hochhuths „Stellvertreter“ wurde uraufgeführt und im Fernsehen lief die groß angelegte WDR/SDR Dokumentarreihe „Das Dritte Reich“, die ein Millionen-Publikum mit den Verbrechen, die im Namen des deutschen Volkes begangen worden waren, konfrontierte. 1965 folgte das Theaterstück „Die Ermittlung“ von Peter Weiss. Aber so bitter es klingen mag, eine breite Beschäftigung der Bevölkerung mit dem Holocaust erreichte erst jene gleichnamige US TV-Serie im Jahre 1979.
Küppers Erstlingsroman erschien bei Middelhauwe in Köln und stieß erfahrungsgemäß auch auf Widerstand beim deutschen Publikum, schaffte es aber wenig später sogar zum Taschenbuch beim Fischer Verlag. Die Aufmerksamkeit beim internationalen Publikum, der Roman erschien in immerhin sieben Sprachen, war umso größer. „Endlich ein Deutscher, der sich erinnert, Nazi gewesen zu sein!“ übertitelte der Figaro Littéraire sein Interview mit dem jungen Autor. Was die in- und ausländischen Rezensenten faszinierte, ist die für die damalige Zeit seltene Schonungslosigkeit, mit der Küpper seine autobiografischen Erinnerungen als Roman verarbeitet 7. Natürlich erfindet er hier und dort Geschehnisse und Personen – in seinem Nachwort zur Wiedererscheinung im Verlag Landpresse im Jahre 1997 hat er sich von einigen Erfindungen auch deutlich distanziert – aber nie hat Küpper den wundesten Punkt seiner autobiografischen Figur verschwiegen: dass er als Pimpf und Jungscharführer den großen Wunsch hatte, SS-Offizier zu werden. Natürlich benutzt Küpper seine Jugend als Schutzschild, mit 14 musste er in der Nachkriegszeit keine Entnazifizierung durchlaufen und sich durch das Ende des Krieges keiner späteren Prüfung stellen, was er denn als Mitglied der SS getan bzw. verbrochen hätte. Insofern blieb er beim Topos des Schelmenromans, den er sich bei dem im 17. Jahrhundert entstandenen Roman „Der abenteuerliche Simplicissimus Teutsch“, abgeschaut hatte. Wie weit entfernt der andere, viel erfolgreichere Schelmenroman jener Nachkriegsjahre, „Die Blechtrommel“ von Günther Grass, ebenfalls mit viel autobiografischen Inhalt gespickt, von der dunklen Seite des Autors entfernt war, zeigte erst die kürzlich verlaufene Diskussion um Grass’ Mitgliedschaft in der Waffen-SS. Der kleinwüchsige Zwerg Oscar in der Psychiatrie konnte von dort aus das Dritte Reich beschreiben, ohne seinen Autor zu diskreditieren.
Sieht man die Sprache, die Küpper verwendet, ganz in der Tradition seines großen Vorbilds Grimmelshausen, so fällt das Grundmotiv der Verballhornung und Verdrehung der NS Sprachfloskeln auf, so wie sie etwa in dem wiederholt angebrachten Spruch „Granaten der Zukunft“ vorkommt. Küpper verwendet im Roman bewusst die Sprache aus dem „Wörterbuch des Unmenschen“ 8, die sich Anfang der 60er noch hartnäckig hält, ob in den diversen Illustrierten oder den Kriegserinnerungsbüchern ehemaliger Nazis; aber aus dem Munde des Kindes, des Jungscharführers (und eben nicht des Hitlerjungen, wie in den Kritiken der 60er Jahre immer wieder behauptet, die bis 14-jährigen waren im sog. Deutschen Jungvolk, auch das hatten die ehemaligen Volksgenossen da schon verdrängt) klingt diese Sprache ihrer eigentlichen Wirkung seltsam beraubt und somit lächerlich gemacht.
Wenn aber Küpper bewusst die Sprache des Dritten Reiches, die LTI, 9 als Stilmittel einsetzte, um ihre Unmenschlichkeit zu entlarven, wie stand es dann um den anderen rheinischen Autor, der damals schon weitaus bekannter war und mit dem Küpper im Übrigen in engem Briefkontakt stand, mit Heinrich Böll? Ich beziehe mich hier konkret auf den 1967 erschienenen Essay „You enter Germany“, 10 ein Text, der mich seinerzeit für die Aufarbeitung des Hürtgenwald-Mythos faszinierte und den ich bis zum heutigen Tage immer wieder gelesen und gehört habe, mit wachsendem Unbehagen. Denn je mehr mir klar wurde, dass sich viele der Legenden und Mythen um diese „vergessene Schlacht“ direkt aus der Propagandaküche von Goebbels in die Nachkriegszeit retteten, begann ich Bölls Sprache zu hinterfragen. Während Küpper die Sprache demontiert, übernimmt der ehemalige Wehrmachtssoldat Böll das Diktum der Wehrmachtsverlautbarungen und Frontzeitungsmeldungen. Da ist von Dörfern, die „den Besitzer wechseln“ die Rede, auch wenn der Tenor des Textes breit ausgestellter Pazifismus ist. Und Böll schreckt noch nicht einmal davor zurück, die Bewohner der Eifel größtenteils als NS-resistent zu beschreiben. Das wollte man eher lesen, als über eine Kleinstadt wie Euskirchen und die Verfolgung politisch anders Denkender, das Martyrium der Zwangsarbeiter und die Verschleppung und anschließende Ermordung der Juden, die mit gleicher Brutalität durchgeführt worden war, als anderswo. Böll machte sich erst unbeliebt mit seinem Spiegel-Artikel zu Ulrike Meinhof. 11
Ich möchte noch einmal festhalten: In jenen muffigen Adenauer-Zeiten in einer Kleinstadt, in der die alten NS-Strukturen noch intakt waren, einen solchen Roman zu schreiben, dazu gehörte Mut. Die Aufarbeitung des Dritten Reiches als Geschichte vor Ort, so wie wir sie heute kennen, geschah erst sehr spät, seit den 80er und 90er Jahren, und sie begann erst in den großen Städten. Umso mehr ist hervorzuheben, dass heutzutage gerade in Euskirchen durch den dortigen Geschichtsverein eine hervorragende Aufarbeitung der Geschichte betrieben wurde und wird. 12 Doch das soll nicht darüber hinwegtäuschen, dass sich die alten Mythen und Legenden nur wenige Kilometer weiter hartnäckig halten.
Der Mythos vom NS-resistenten Rheinländer – wenn das schon ein Friedensnobelpreisträger feststellen konnte! – hält sich im Grenzland ebenso hartnäckig wie die Meinung, viele der Nazis seien von außerhalb gewesen, die wenigen Ortsansässigen hätten sich nur für solche Posten bereit erklärt, um Schlimmeres zu verhindern, und allein schon der Katholizismus habe die Nazis in Schach gehalten. Und je nach Tagesform und Stimmungslage erscheint der Westwallbau mal als schlimme Sache (weil die Bauern enteignet wurden), mal als Infrastrukturmaßnahme (die Arbeitslosen verschwanden ja alle), mal als Friedenswerk und mal als Ursache für die Zerstörung der Heimat, denn: „Wäre nur der Ami in einem durch zum Rhein, dann wäre uns viel erspart geblieben.“ So und ähnlich lauten die immer wieder vorgebrachten Klagen. Man sieht sich nach wie vor als Opfer und die Erinnerung an die deportierten und ermordeten Mitbürger findet dort, wo die Dörfer und die Landschaft am schlimmsten zerstört wurden, nicht statt. Stattdessen: LTI, Propagandasprache, die sich in Heimatpublikationen und örtlicher Bahnhofsliteratur hält wie die Drachenzähne und Bunkerreste an der Grenze, ungebrochen und ohne jegliche Ironie. Und in Sonntagsreden kann man immer wieder von Lokalpolitikern die Worte hören: „Krieg kennt nur Opfer.“ Wer für den Krieg verantwortlich ist, wer daran schuld ist, wird nicht zum Thema gemacht; stattdessen wird der Krieg immer noch zum Naturereignis abgestempelt, über 60 Jahre danach. Sie alle, die noch so reden, sie sollten Küpper lesen, dringend.
_________________________________
1Ein erschütterndes Dokument zur Allgegenwärtigkeit des NS Regimes bis in den kleinsten Winkel der Gesellschaft ist das Otto Webers Buch „Tausend ganz normale Jahre – ein Photoalbum des gewöhnlichen Faschismus“, hrsg. von Hans Magnus Enzensberger. Nördlingen: Greno, 1987 (Die Andere Bibliothek. Sonderband). – Otto Weber lebte im niederrheinischen Kleve und dokumentierte die NS-Jahre von 1933 bis 1945 aus der Sicht des Berufsfotografen.
2Neben schwachen Erinnerungen aus meiner Kindheit habe ich mich bei der Beschreibung der Adenauer-Ära u. a. auf folgenden Quellen gestützt: Peter Reichel, „Vergangenheitsbewältigung in Deutschland“ München: C. H. Beck, 2001; Norbert Frei, „1945 und wir“. Erweiterte Taschenbuchausgabe München: dtv, 2009; sowie „Lexikon der ‚Vergangenheitsbewältigung’ in Deutschland“, hrsg. von Torben Fischer und Matthias N. Lorenz. Bielefeld: Transcript, 2007.
3 Wigbert Benz, „Paul Carell. Ribbentrops Pressechef Paul Karl Schmidt vor und nach 1945“. Berlin: WV, 2005.
4 Siehe dazu Michael Reynolds, „The Devil's Adjutant“, Spellmount: [o. O.], 2002, S. 262. - Gemeint ist der ehemalige SS Hauptsturmführer Josef „Sepp“ Diefenthal.
5 „Die antisemitischen und neonazistischen Vorfälle der Jahreswende 1959/1960 rückten die nationalsozialistische deutsche Vergangenheit unvermittelt in das Blickfeld der Bundesregierung. Hakenkreuzschmierereien an der Kölner Synagoge am Weihnachtsabend 1959 und eine Welle von mehreren hundert Nachahmungstaten im In-, aber auch im Ausland hatten international für Aufsehen gesorgt und Ressentiments gegen Deutschland neue Nahrung verliehen. Angesichts der bedrohlichen Folgen für das internationale Ansehen der Bundesrepublik und der möglichen negativen Rückwirkungen auf die anstehenden deutschlandpolitischen Verhandlungen war sich das Kabinett über die Notwendigkeit einer schnellen und wirkungsvollen Bestrafung der Täter einig.“
Zitiert nach Bundesarchiv, Kabinettsprotokolle online. Weitere Informationen finden sich hier: http://www.bundesarchiv.de/cocoon/barch/0020/k/k1960k/kap1_1/para2_3.html.
6 Zur umstrittenen Rolle der Gruppe 47 empfiehlt sich u. a. der Aufsatz von Stephan Braese „Deutschsprachige Literatur und der Holocaust“, erschienen in „Politik und Zeitgeschichte“ 50/2007, hrsg. von der Bundeszentrale für politische Bildung, online nachzulesen unter:
http://www.bpb.de/publikationen/UMQ1L4,3,0, Deutschsprachige_Literatur_und_der_Holocaust.htm.
7 Der Editor Armin Erlinghagen schreibt am 30.08.2006 in einem Leserbrief zu Peter Mohrs Rezension des Grass-Romans „Vom Häuten der Zwiebel“ zur Haltung Küppers:
„Im Figaro Littéraire (Paris) erschien im Frühjahr 1967 ein längeres Interview mit dem Titel „Endlich ein Deutscher, der sich erinnert, Nazi gewesen zu sein!“ In besagtem Interview findet sich folgende Passage:
P.D.: Was wollten sie einmal werden?
H.K.: SS-Offizier.
P.D.: Und wann, denken Sie, hätten Sie diesen Rang erreicht?
H.K.: 1948.“
Der zitierte Dialogausschnitt ist, außer durch seinen Inhalt, vor allem darum von Interesse, weil er in der strittigen Sache die Identität des Autors mit dem fiktiven Ich-Erzähler des genannten Romans belegt. Der Dialog nimmt an dieser Stelle offensichtlich Bezug auf eine Sequenz aus dem (im Kern autobiographischen) Roman „Simplicius 45“; sie lautet: „Ich konnte wegen Kurzsichtigkeit nicht zur Luftwaffe, aber ich hatte etwas viel Besseres, ich wurde Offizier der Waffen-SS.“
Quelle: http://www.literaturkritik.de/public/mails/rezbriefe.php?rid=9846.
8 Dolf Sternberger, Gerhard Storz und , „Aus dem Wörterbuch des Unmenschen. Neue erweiterte Ausgabe mit Zeugnissen des Streites über die Sprachkritik“. Überarbeitete Ausgabe. München: dtv, 1970.
9 "LTI" - Lingua Tertii Imperii – ist ein Begriff des Philologen Victor Klemperer (1881-1960), den dieser in seiner 1947 erschienenen Untersuchung, die als erste profunde Kritik der "Sprache des Dritten Reiches" galt, verwendete. Vgl. Victor Klemperer, „LTI: Notizbuch eines Philologen“. Stuttgart: Reclam, Nachdruck der 22. Auflage 2007.
10 „You enter Germany“. Essay von Heinrich Böll, in „Heimat und keine. Schriften und Reden 1964-1968“. München: dtv, 1985.
11 „Will Ulrike Gnade oder freies Geleit?“. Essay von Heinrich Böll, in: Der Spiegel, 10. Januar 1972.
12 „Nationalsozialismus im Kreis Euskirchen. Die braune Vergangenheit einer Region.“ 2 Bde. Jg. 21 (2007). (Jahresschrift Geschichtsverein des Kreises Euskirchen e.V.)
„Simplicius 45“ von Heinz Küpper, Vorwort zur Neuausgabe von Achim Konejung. Hier online lesen.
18.04.10
„Simplicius 45“ von Heinz Küpper, Vorwort zur Neuausgabe von Achim Konejung.